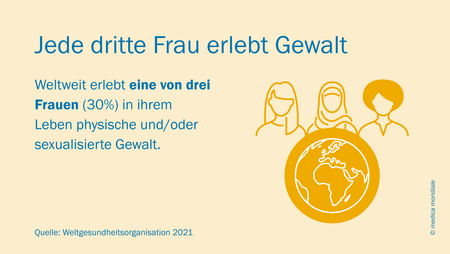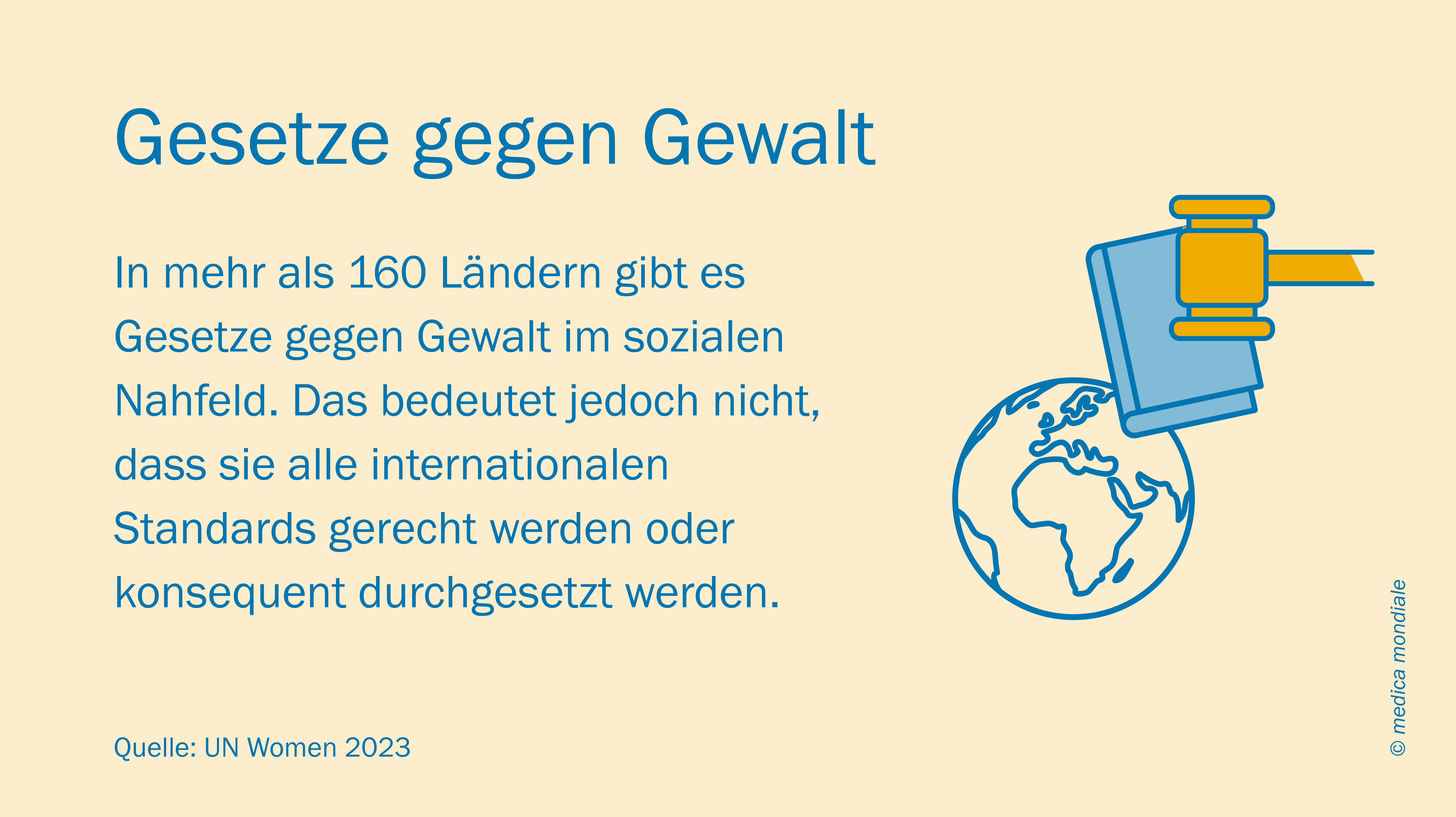Gewalt gegen Frauen: Ursachen und Folgen

Gewalt gegen Frauen ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Sie bringt Frauen in Lebensgefahr, gefährdet ihre körperliche und seelische Gesundheit sowie das Wohl ihrer Kinder. Gewalt gegen Frauen hat Folgen für die ganze Gesellschaft. Die Täter:innen sind Menschen jeglichen sozialen und ökonomischen Hintergrunds. Die Mehrheit von ihnen ist männlich.
Gewalt gegen Frauen ist in patriarchal geprägten Gesellschaften Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Die Ursachen der Gewalt liegen daher nicht nur auf individueller, sondern insbesondere auf struktureller Ebene. Die Ursachen müssen beseitigt und weitere Gewalt verhindert werden. Nur wenn frauenfeindliche Strukturen aufgelöst werden, kann Geschlechtergerechtigkeit geschaffen werden. Dann können Frauen und Mädchen gewaltfrei leben.
Welche Formen von Gewalt gibt es?
Es gibt verschiedene Erscheinungsformen der Gewalt: sexualisierte, physische, psychische, soziale und finanzielle Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist eine Ausprägung von geschlechtsspezifischer Gewalt und auch Ausdruck von Diskriminierung. Frauen werden nicht nur aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Oft sind sie zusätzlich von weiteren Diskriminierungsformen betroffen, beispielsweise von Rassismus, Homophobie oder Ableismus, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken.
Was ist häusliche Gewalt?
Häusliche Gewalt bzw. Gewalt im sozialen Nahfeld bezeichnet jegliche Gewalt, die durch nahestehende Personen ausgeübt wird. Es handelt sich dabei um eine international anerkannte Menschenrechtsverletzung. Ziel dieser Gewalt sind Machtausübung und Kontrolle. Meistens wird die sogenannte häusliche Gewalt innerhalb einer Familien- oder (ehemaligen) Intimbeziehung ausgeübt. Weil nicht der Ort des Geschehens diese Form der Gewalt definiert, sondern die gewaltausübende Person, nutzt medica mondiale statt „häuslicher Gewalt“ bevorzugt Begriffe wie partnerschaftliche Gewalt oder Gewalt im sozialen Nahfeld.
Was ist psychische Gewalt?
Psychische Gewalt beschreibt Handlungen, die emotionale und seelische Verletzungen der Betroffenen zur Folge haben. Psychische Gewalt zeigt sich in Einschüchterungen durch Blicke, Gesten oder Schreien, in Zwängen und Drohungen - etwa Frauen ihre Kinder wegzunehmen oder Gewalt anzuwenden. Auch Erniedrigungen, abwertende und diskriminierende Kommentare sowie Lächerlichmachen in der Öffentlichkeit sind Formen psychischer Gewalt. Kontrolle, dominierendes Verhalten oder extreme Eifersucht sowie die Isolation der Betroffenen gehen oft mit emotionaler Gewalt einher. Psychische Gewalt erfolgt auch online durch sogenannte Cyber Violence.
Was versteht man unter sexualisierter Gewalt?
Sexualisierte Gewalt bezeichnet sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person. Es ist eine Zuwiderhandlung gegen das rechtlich geschützte sexuelle Selbstbestimmungsrecht. Sexualisierte Gewalt ist eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt. Sie reicht von verbaler Belästigung über ungewollte Berührungen bis hin zu Vergewaltigung und Genitalverstümmelung.
Mit welchem Ziel wird sexualisierte Gewalt ausgeübt?
Bei sexualisierter Gewalt geht es immer um Machtausübung, Kontrolle und die Unterdrückung des Gegenübers. Sie drückt sich in gewalttätigen sexuellen Handlungen aus, die nicht einvernehmlich sind. Das heißt, die Gewalt wird sexualisiert. Es geht nicht oder nicht vorrangig um sexuelle Befriedigung.
Unter welchen Bedingungen wird sexualisierte Gewalt ausgeübt?
Sexualisierte Gewalt ist eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung, die in Krisen und Kriegen vermehrt als Machtinstrument eingesetzt wird und auch in Friedenszeiten fortbesteht. Sie ist Ausdruck patriarchaler Strukturen, weltweit verbreitet in allen Kulturen, Religionen und Gesellschaften. Sexualisierte Gewalt kommt in allen sozialen Schichten und Einkommensklassen vor.
Was bewirkt sexualisierte Kriegsgewalt im Umfeld der Opfer?
In Kriegen wird sexualisierte Gewalt gegen Frauen auch mit der Absicht ausgeübt, die Männer der gegnerischen Gruppe zu demütigen. Eine grausame symbolische Botschaft, die auf patriarchale Denkmuster zurückzuführen ist. Sexualisierte Kriegsgewalt ist nur deshalb so wirkmächtig, weil sich alle Beteiligten des Konfliktes innerhalb dieser Denkmuster bewegen. Weltweit werden Frauen und insbesondere ihre Körper immer noch als Besitz ihrer Ehemänner, Väter und Familien betrachtet.
Was ist die symbolische Botschaft sexualisierter Kriegsgewalt?

Wird eine Frau vergewaltigt, gilt der Besitz des Mannes, also ihr Körper, nicht selten als beschädigt. Dem Feind wird signalisiert, dass er nicht in der Lage war, die Frau zu beschützen. Bei Kriegsvergewaltigungen überlagern sich zudem oft sexistische und rassistische Motive: Eine Frau wird als Symbol einer anderen ethnischen Gruppe gesehen und ihre Vergewaltigung demonstriert die eigene Überlegenheit.
Wer sind die Täter:innen von Gewalt gegen Frauen?
Zu den Täter:innen von Gewalt gegen Frauen zählen Menschen jeglicher sozialer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion sowie jeglichen Alters, Bildungs- oder ökonomischen Hintergrunds. Die Mehrheit der Täter:innen weltweit ist männlich, im Fall sexualisierter Gewalt sogar fast ausschließlich. Meist kommen sie aus dem engeren Umfeld der Betroffenen. Dass eine unbekannte Person nachts im Park vergewaltigt, ist deutlich seltener.
Die Täter:innen tragen auf individueller Ebene die alleinige Verantwortung für ihr Handeln und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist jedoch relevant, die strukturellen Ursachen der Gewalt zu erkennen und zu bekämpfen.
Welche Ursachen hat Gewalt gegen Frauen?
Verantwortlich für eine Vergewaltigung ist niemals die gewaltbetroffene Person. Weder ihr Verhalten noch ihr Aussehen oder ihre Kleidung rechtfertigen Gewalt. Auf struktureller Ebene wird Gewalt zum Beispiel durch private und öffentliche Institutionen sowie bei politischen Maßnahmen ausgeübt, die Frauen diskriminieren. Die Ungleichbehandlung von Frauen fußt dabei auf überholten Stereotypen und Rollenzuschreibungen für Männer und Frauen. Das Geschlecht eines Menschen wird sozial konstruiert und ist keineswegs nur „natürlich“ oder „biologisch“ festgelegt. Das heißt, auch Männlichkeit ist ein soziales Konstrukt, das im Rahmen patriarchaler Rollenerwartungen oft mit Aggression verbunden wird. Um Gewalt gegen Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu begegnen und vorzubeugen, hat medica mondiale den Mehrebenenansatz entwickelt.
Definition: Strukturelle Ursachen von Gewalt gegen Frauen
Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen findet nicht nur auf einer individuellen Ebene statt, sondern ist in den kulturellen und institutionellen Strukturen von Gesellschaften verankert. Das Zusammenwirken diskriminierender Handlungen auf allen drei Ebenen wird als strukturelle Gewalt bezeichnet. Strukturelle Gewalt kommt beispielsweise in diskriminierenden Regeln, Gesetzen, Gebräuchen und Traditionen, aber auch durch frauenfeindliche Sprache zum Ausdruck. Menschen werden in ihrer Art zu denken, ihren Ansichten sowie ihrem Handeln bewusst sowie unbewusst von diesen Strukturen beeinflusst. Umgekehrt festigen Menschen, die innerhalb dieser Strukturen sozialisiert sind, ihrerseits die Strukturen. Ein Kreislauf, in dem Sexismus und daraus resultierend auch Gewalt gegen Frauen fortbestehen und sich manifestieren.
Beispiele für strukturelle Ursachen von Gewalt gegen Frauen
Während Dominanz, Macht und Stärke als männlich gelten, werden Frauen Attribute wie Unterlegenheit, Passivität oder Duldsamkeit zugeschrieben. Aufgrund dieser Zuschreibungen werden Frauen bis heute von wichtigen politischen Entscheidungsprozessen und Ämtern ausgeschlossen. Diese mangelnde Repräsentanz in relevanten gesellschaftlichen Bereichen führt dazu, dass die Bedarfe von Frauen keine Beachtung finden und Gewalt sich verstetigt. Dies spiegelt sich auch auf rechtlicher Ebene wider: So hat beispielsweise nur rund ein Viertel aller Länder Gesetze bezüglich Vergewaltigung in der Ehe. Auch in Deutschland ist Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar. Ein weiteres Beispiel für strukturelle Gewalt ist Sexismus am Arbeitsplatz. Dieser umfasst unter anderem frauenfeindliche Äußerungen, weniger Gehalt für dieselbe Arbeit sowie einen wesentlich geringeren Frauenanteil in leitenden Positionen.
Zahlen & Fakten zu Gewalt an Frauen
- Im Jahr 2022 wurden 11.896 Fälle besonders schwerer Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriff einschließlich Todesfolge gemeldet. 87 Prozent der Opfer waren Frauen. Vor Gericht können viele männliche Täter mit Milde rechnen.
- Gewalt im sozialen Nahfeld:
- Jeden dritten Tag wird eine Frau durch ihren (ehemaligen) Partner getötet.
- 2022 waren laut Bundeskriminalamt 157.818 Menschen von Gewalt in Partnerschaften betroffen, die meisten von ihnen – 80 Prozent – waren Frauen.
- Über 4.500 Personen haben sexualisierte Gewalt im sozialen Nahfeld erlebt. 96 Prozent von ihnen waren weiblich. Die Zahl der Betroffenen ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen. 2022 waren es über 240.000 Menschen – 13 Prozent mehr als 2018.
- Mehrfachdiskriminierung: Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sind zwei- bis dreimal häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen.
- In Europa ist die Zahl der Femizide seit 2019 deutlich gestiegen. Am stärksten war der Anstieg in Griechenland, Slowenien, Deutschland und Italien.
- Strafverfolgung: In einer Studie (2019) gaben doppelt so viele Frauen wie Männer an, Angst vor Vergeltung durch die gewaltausübende Person zu haben, wenn sie den Vorfall den Behörden melden. Eine Fallstudie (2019) belegt: Frauen, die sich aufgrund von Partnerschaftsgewalt an die Polizei wenden, bleiben in zwei von drei Fällen ohne Schutz vor erneuter Gewalt.
- Cyber Violence: Jede zehnte Frau in der Europäischen Union hat bereits Gewalt im Internet erfahren.
- Gewalt im sozialen Nahfeld: Jede Stunde werden statistisch betrachtet mehr als fünf Frauen und Mädchen von einem Familienmitglied ermordet. Über 640 Millionen Frauen ab 15 Jahren – das ist jede Vierte – haben Gewalt durch ihre:n Partner:in erlebt.
- Strafverfolgung: Weniger als 40 Prozent der Frauen, die Gewalt erfahren, suchen Hilfe. Viele Überlebende haben Angst vor weiterer Gewalt, sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung und/oder Angst davor, dass ihnen Hilfe verweigert wird. Wer Unterstützung sucht, wendet sich meistens an Freund:innen und Familienmitglieder. Weniger als 10 Prozent erstatten Anzeige bei der Polizei.
- Die Folgen der Klimakrise erhöhen das Risiko für Frauen und Mädchen, Gewalt zu erleben.
- Mehrfachdiskriminierung: Für Frauen mit Behinderung ist das Risiko, sexualisierte Gewalt zu erleben, zehn Mal höher als für Frauen ohne Behinderung.
Welche Folgen hat die Gewalt für die betroffenen Frauen?

Gewalt kann schwerwiegende Auswirkungen auf physischer, psychischer und sozialer Ebene haben, bis hin zum Tod. Dies trifft auch auf sexualisierte Gewalt zu. Folgen sexualisierter Gewalthandlungen können unter anderem Unfruchtbarkeit und Geschlechtskrankheiten, Trauma, Depressionen, Angstzustände und Panikattacken sein. Beschwerden psychosomatischen Ursprungs entstehen unter anderem durch die Verdrängung der Gewalt, zu der sich viele Frauen gezwungen sehen. Zudem wird Frauen häufig eine Mitschuld an der Gewalt gegeben, ihnen wird nicht geglaubt oder sie werden von ihrem Umfeld stigmatisiert.
Welche Folgen hat die Gewalt für die Familien der Betroffenen?
Gewalt gegen Frauen richtet sich immer auch gegen ihre Kinder, selbst wenn diese nicht direkt angegriffen werden. Das bloße Miterleben der Gewalt kann beispielsweise zu Schlafstörungen, Entwicklungsverzögerungen, Aggressivität oder Ängstlichkeit führen. Besonders schwerwiegend ist, dass Gewaltverhalten sowie durch Gewalt ausgelöste Traumata über Generationen hinweg vererbt werden können. Kinder, die Gewalt und deren Folgen miterleben, erlernen und akzeptieren Gewalt als Konfliktlösungsmuster. Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, können die traumatische Erfahrung als transgenerationales Trauma in Form von Ängsten, Schutz¬ oder Stressreaktionen unbewusst an Kinder und Enkelkinder weitergeben. Dies kann die emotionale familiäre Bindung beeinträchtigen.
Welche Folgen hat die Gewalt gegen Frauen für die Gesellschaft?
Gewalt gegen Frauen hat weitreichende Folgen für die Gesellschaft. Transgenerationale Traumata, die von Überlebenden sexualisierter Gewalt an ihre Kinder weitergegeben werden können, beeinträchtigen die psychische Gesundheit ganzer Familien. Insbesondere kollektiv erlebte Gewalt, wie sexualisierte Kriegsgewalt, beeinträchtig das soziale Gefüge über Generationen hinweg. Patriarchale Strukturen, die auf Sexismus und weiteren Diskriminierungsformen gründen, erzeugen ein Klima der Gewalt, in dem Frauen sich im öffentlichen Raum nicht angstfrei bewegen und entfalten können.
Durch die Einschränkungen von Frauen beim Zugang zu Bildung sowie der Berufswahl lassen Gesellschaften das Potential der Hälfte ihrer Bevölkerung ungenutzt. Geringe Bildungschancen von Mädchen wiederum stehen in direktem Zusammenhang mit Armut, Kinder- und Müttersterblichkeit und sogar der Klimakrise. Denn Naturkatastrophen können den Zugang zu Bildung versperren. Überschwemmungen zerstören Schulwege und Klassenzimmer, Dürren stürzen Familien in die Armut. Gleichzeitig braucht die Welt gut ausgebildete Mädchen und Jungen, die Strategien entwickeln, um die Folgen der Klimakrise zu mildern und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Welche Folgen hat Gewalt gegen Frauen für Staat & Wirtschaft?

Die Teilhabe von Frauen ist in vielen politischen und wirtschaftlichen Bereichen aufgrund ihrer Diskriminierung stark eingeschränkt. Studien zeigen, dass das Ausmaß der Teilhabe von Frauen direkten Einfluss auf die Stabilität eines Staates sowie seines wirtschaftlichen Erfolg hat. Frauen, die Gewalt erlitten haben, fallen aufgrund physischer und psychischer Verletzungen häufiger bei der Arbeit aus, was die Produktivität von Unternehmen verringert und der Volkswirtschaft bedeutende Schäden zufügt.
Die Gesellschaft trägt darüber hinaus die Kosten für Gewalt gegen Frauen in Form von Kosten für Frauenhäuser, Gerichtsverfahren, Polizeieinsätze oder psychologische und medizinische Behandlungen. Außerdem: Wie die UN-Resolution 1325 anerkennt, ist sexualisierte Gewalt nicht nur ein ernsthaftes Hindernis für erfolgreiche Friedensprozesse, sondern gefährdet auch nachhaltigen Frieden und Stabilität. Friedensabkommen, die ohne Beteiligung von Frauen entstanden sind und deren Bedarfe nicht einbeziehen, können auf Dauer nicht erfolgreich sein.
Gewalt gegen Frauen: eine Staatsangelegenheit
Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, das verhindert werden kann und muss. Dennoch werden Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, beispielsweise Femizide, in den Medien oder im Rahmen von Gerichtsurteilen, häufig banalisierend als „Familiendramen“ bezeichnet. Diese Wortwahl ist Teil des strukturellen Problems. Sie verharmlost Gewalt gegen Frauen; Verantwortliche und Ursachen werden nicht klar benannt. Der Staat ist dazu verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, Schutz und Unterstützung für die Betroffenen sowie die Strafverfolgung der Täter:innen zu gewährleisten. Nur mit einer staatlichen Gesamtstrategie, die auch die Ursachen von Gewalt gegen Frauen einbezieht, können Maßnahmen entwickelt werden, die wirksam sind.
Beispiele für staatliche Interventionsmöglichkeiten
Durch Fortbildungen kann beispielsweise Personal im Gesundheits- oder Justizsektor zu Gewalt gegen Frauen sensibilisiert werden. Durch aufklärende Öffentlichkeitsarbeit, geschlechtergerechte Erziehung und Menschenrechtsbildung sowie eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt kann dieser vorgebeugt und einer frauenfeindlichen Haltung entgegengewirkt werden.
Was kann die Gesellschaft tun gegen Gewalt an Frauen?

Jeder Mensch kann Vorbild für geschlechtergerechtes Verhalten sein. Das eigene Handeln zu reflektieren sowie gesellschaftliche Normen zu hinterfragen, kann aufzeigen, wo von der Gesellschaft vorgelebtes, sexistisches Denken und Verhalten unbewusst übernommen werden.
- Solidarität mit Frauen stärkt das soziale Miteinander und nimmt Gewalt gegen Frauen den Raum. Klar Haltung gegen jede Form von Gewalt gegen Frauen und deren Diskriminierung zu beziehen, setzt ein deutliches Zeichen.
- Durch den Verzicht auf frauenfeindliche Produkte und Kritik an solchen Unterhaltungsformaten kann Stellung bezogen und die Reproduktion frauenfeindlicher Werte unterbunden werden.
- Personen im Bereich Bildung, Presse, Kultur, Werbung, aber beispielsweise auch bei der Entwicklung von Computerspielen nehmen wichtige Vorbildfunktionen ein und können als Multiplikator:innen wirken, indem sie für geschlechtergerechte Darstellungen eintreten.
- Gewaltausübende Personen sind für ihr Verhalten selbst verantwortlich und können sich gegen Gewalt entscheiden.
- Zeug:innen von Gewalt können sich an entsprechende Beratungsstellen wenden und Unterstützung vermitteln.
Hinsehen & Handeln: Beispiele unserer Arbeit
medica mondiale und ihre Partnerorganisationen machen öffentlich auf sexualisierte Gewalt aufmerksam und klären über die Ursachen und Folgen von Gewalt gegen Frauen auf. Die Öffentlichkeit sowie Politiker:innen werden zur Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frauen aufgefordert. Ziele sind unter anderem politische Maßnahmen gegen sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt sowie die diskriminierungsfreie Unterstützung von Überlebenden.
1. Aufklärungsarbeit: Das Tabu sexualisierter Gewalt brechen

Im Rahmen unserer Aufklärungsarbeit sprechen wir gezielt verschiedenste Akteur:innen an, um das gesellschaftliche Tabu zu brechen und einen strukturellen Wandel zu bewirken. So macht unsere bosnische Partnerorganisation „Forgotten Children of War“ mit der Fotoausstellung „Break Free“ auf die Situation von Müttern und ihren in Folge von sexualisierter Kriegsgewalt geborenen Kindern aufmerksam. Und in Liberia klärt unsere Partnerorganisation Medica Liberia Dorfbewohner:innen mittels Radio über Frauenrechte auf. Zuhörer:innen können per Anruf oder SMS Fragen an ein:e Rechtsberater:in stellen. Männer werden gezielt angesprochen, um sich aktiv für Frauen und Mädchen einzusetzen.
2. Ganzheitliche Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen

Unsere Partnerorganisationen unterstützen Überlebende sexualisierter Gewalt im Rahmen unseres stress- und traumasensiblen Ansatzes (STA) ® ganzheitlich und langfristig. Beispiele hierfür sind gesundheitliche und psychosoziale Beratung sowie Rechtshilfe und Einkommen schaffende Maßnahmen. Unsere bosnische Partnerorganisation Budućnost bildet Frauen und Mädchen in landwirtschaftlicher Produktion weiter, damit sie selbstständig ihren Lebensunterhalt sichern können.
3. Advocacy-Arbeit: Struktureller Wandel für Frauen, gegen Gewalt

Durch politische Advocacy-Arbeit setzt sich medica mondiale gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen bei politischen Akteur:innen für die Belange von Überlebenden sexualisierter Gewalt ein. Wir sensibilisieren Politik und Regierungen weltweit zu Gewalt gegen Frauen und fordern diese auf, Frauenrechte einzuhalten und bestehende Gesetze zum Schutz von Frauen anzuwenden. Die Interessen und Bedürfnisse Überlebender sollen in politischen Entscheidungsprozessen Beachtung finden, gewalterhaltende Strukturen durchbrochen und Gewalt so langfristig vorgebeugt werden. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass Überlebende sexualisierter (Kriegs-)Gewalt angemessene Unterstützung oder Entschädigung erhalten.
Beispiele aus Deutschland, Südosteuropa und Afghanistan
In Deutschland macht sich medica mondiale im Rahmen der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen sowie für die Agenda „Frauen, Frieden, Sicherheit“ stark. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Resolution 1325 konsequent umzusetzen, damit Frauen und Mädchen in Konflikten geschützt sind und an Friedensprozessen mitwirken können. Im Kosovo konnte Medica Gjakova dazu beitragen, dass Frauen und Mädchen, die während des Kosovokrieges vergewaltigt wurden, eine monatliche Rente erhalten. Und in Bosnien und Herzegowina verabschiedete das Parlament nach langjährigem Einsatz unserer Partnerorganisationen im Juli 2022 ein Gesetz zur rechtlichen Anerkennung von Menschen, die aufgrund von Kriegsvergewaltigungen geboren wurden.