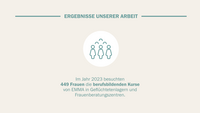Frauenrechte in der Autonomen Region Kurdistan – Irak

Der Irak kommt nicht zur Ruhe. Jahrelange Sanktionen, bewaffnete Konflikte und politische Instabilität haben Spuren hinterlassen. In beiden Landesteilen – Zentralirak und der Autonomen Region Kurdistan im Irak (Kurdistan Region of Iraq – KRI) – machen es patriarchale Normvorstellungen und anhaltende Konflikte vielen Frauen unmöglich, selbstbestimmt zu leben.
Geschlechtsspezifische Gewalt im Irak weit verbreitet
Geschlechtsspezifische Gewalt ist im Irak weit verbreitet. Besonders geflüchtete Frauen und Mädchen – viele von ihnen stammen aus Syrien oder sind Binnenvertriebene – sind von sexualisierter Gewalt bedroht. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Aktivist:innen, die sich für Frauen- und Menschenrechte einsetzen, geraten zunehmend ins Visier religiöser Fundamentalist:innen, des Staates und bewaffneter Milizen. Trotz der Bedrohung machen sich Aktivist:innen weiterhin stark für ein gleichberechtigtes und sicheres Leben für Frauen und Mädchen.
„Wenn wir es schaffen, dem Leben der Frauen wieder Sinn zu geben, hilft ihnen das bei der Genesung.“
Neun Fakten über Frauenrechte im Irak
1. Recht auf Schutz vor Gewalt nicht durchgesetzt

Die irakische Verfassung verbietet jede Form von Gewalt in der Familie. In der Autonomen Region Kurdistan im Irak ist der Schutz vor Gewalt gegen Frauen, einschließlich weiblicher Genitalverstümmelung, seit 2011 im Familiengesetz verankert. Gleichzeitig haben Ehemänner das Recht, ihre Frauen zu bestrafen, und Vergewaltiger entgehen der Strafverfolgung, wenn sie die Frau heiraten, der sie Gewalt angetan haben. Frauenhäuser gibt es nur wenige. Sie sind schlecht ausgestattet und können selten angemessene Unterstützungsangeboten für die Überlebenden bieten.
Religiös-konservative Normvorstellungen
Frauenrechten stehen religiös-konservative Normvorstellungen, wachsender Extremismus und Militarismus entgegen. So erleben Frauen und Mädchen im Irak weiterhin Gewalt und Diskriminierung.
2. Diskriminierende Gesetze
Im Zentralirak und in der KRI gilt eine religiöse Gesetzgebung. Das heißt, dass jede anerkannte religiöse Gruppe familien- und personenstandrechtliche Angelegenheiten regeln kann. Diese Gesetze und ihre oft konservative Auslegung begünstigen sexualisierte Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Mädchen. Überlebende werden nicht nur stigmatisiert. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit haben sie auch kaum Chancen, sich aus einer Gewaltsituation zu lösen oder rechtlich dagegen vorzugehen.
3. Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe

Die Verbrechen an den Jesid:innen und anderen Minderheiten (wie Christ:innen, Turkmen:innen und Schakak:innen) im Jahr 2014 durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) sind das jüngste Kapitel sexualisierter Kriegsgewalt gegen Frauen im Irak. Tausende Frauen und Mädchen wurden verschleppt, vergewaltigt und in die Sklaverei verkauft. Noch immer werden rund 2.800 Frauen und Kinder vermisst.
Die Vereinten Nationen (UN), das Parlament der Europäischen Union (EU) und viele nationale Regierungen erkennen den Völkermord an den Jesid:innen an und bewerten die Taten des sogenannten IS als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Deutsche Bundestag folgte im Januar 2023.
Die Verbrechen gegen jesidische Frauen und Mädchen reihen sich ein in eine Geschichte der Grausamkeiten gegen Iraker:innen: In den 1980er Jahren setzte der damalige Diktator Saddam Hussein während der Anfal-Kampagne sexualisierte Gewalt gegen kurdische Frauen ein. Auch nach der US-Invasion und dem Sturz des Regimes von Hussein 2003 wurden nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen unzählige Frauen entführt, vergewaltigt und getötet.
4. Jesid:innen und ihre Kinder nach dem Genozid
Noch immer werden rund 2800 Frauen und ihre Kinder vermisst. Jesid:innen, die sexualisierte Gewalt überlebt haben, leiden unter gesellschaftlichem Stigma. Weder sie, noch ihre Kinder, von denen viele in der IS-Gefangenschaft geboren wurden, erhalten Unterstützung.
Gesetz soll Überlebende besser schützen
Im März 2021 verabschiedete das irakische Parlament ein Gesetz (Yazidi Female Survivor Law), das überlebende Jesid:innen und Überlebende anderer Minderheiten wie Christ:innen, Turkmen:innen und Schakak:innen besser schützen soll. Darin werden zudem die strategische Vergewaltigung und Versklavung durch den sogenannten Islamischen Staat als Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt. Mit dem Gesetz wurde eine Generaldirektion für Angelegenheiten der Überlebenden eingerichtet, die für die Entschädigung der Überlebenden im Irak und in der Diaspora zuständig ist. Allerdings mangelt es an einer adäquaten Umsetzung des Gesetzes. Das Verfahren zur Beantragung der Entschädigung ist teuer und bürokratisch. Während des langwierigen Verfahrens stehen Überlebenden keine stress- und traumasensible psychosoziale und rechtliche Begleitung zur Seite, um sie vor Retraumatisierung zu schützen.
5. Gewalt in der Familie
Neben sexualisierter Kriegsgewalt erleben viele Frauen und Mädchen im Irak Gewalt durch männliche Familienmitglieder. Die Covid-19-Pandemie löste eine „Schattenpandemie“ innerfamiliärer Gewalt aus, deren Folgen noch immer zu spüren sind. Laut Angaben des Obersten Justizrates wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 mehr als 10.000 Fälle von partnerschaftlicher Gewalt innerfamiliärer Gewalt registriert.
Aus finanzieller Not werden zudem viele Frauen und Mädchen früh oder unfreiwillig verheiratet. Sowohl im Zentralirak als auch in der KRI kommt es immer wieder zu Femiziden. Doch nur selten werden die Morde strafrechtlich verfolgt und dokumentiert.
6. Geflüchtete Frauen und Mädchen besonders gefährdet

Insgesamt leben rund 290.000 Geflüchtete im Irak. Hinzu kommen mehr als eine Million Binnenvertriebene. Viele von ihnen waren 2014 vor dem sogenannten IS geflohen. Bis heute fehlt es in den zerstörten Dörfern und Städten an Elektrizität und Wasser, an Krankenhäusern und Schulen. Auch die Sicherheit der Bewohner:innen kann der Staat nicht garantieren.
Geflüchtete und vertriebene Frauen sind verstärkt von geschlechterbasierter und sexualisierter Gewalt betroffen. Neben partnerschaftlicher Gewalt und Frühverheiratung erfahren sie auch wirtschaftliche Gewalt, etwa das Zurückhalten von Geld. Scham, Stigmata und der Verlust sozialer Netzwerke hindern sie, gegen die erlebte Gewalt vorzugehen.
Armut und Perspektivlosigkeit
Das Leben vieler Geflüchteter ist geprägt von Perspektivlosigkeit und einem zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf Frauen und Mädchen, der sich besonders auf frauengeführte Haushalte auswirkt. Die Zahl der Suizide in der Region steigt seit Ende 2020 besorgniserregend an. Seit Anfang 2021 nehmen sich auch immer mehr Menschen in den Aufnahmegemeinschaften das Leben.
7. Krise im Gesundheitswesen
Auf 1.000 Personen kommen im Zentralirak 1,3 Krankenhausbetten und nicht mal ein:e Ärzt:in. In der KRI sind es 1,5 Betten und 1,4 Ärzt:innen. Oft fehlen selbst Basismedikamente. Die Krise im Gesundheitswesen ist Folge von jahrelangem Missmanagement, Korruption und fehlenden Investitionen. Die meisten Iraker:innen sind nicht versichert und müssen krankheitsbedingte Kosten privat tragen. Patriarchale Normen, Stigmata und Scham erschweren Frauen, die sexualisierte oder geschlechtsbasierte Gewalt erfahren haben, zusätzlich den Zugang zu Gesundheitsdiensten.
8. Die Jugend ist die Hoffnung
Scheint die Frauenrechtslage im Irak angesichts der anhaltenden Gewalt manchmal aussichtslos, so gibt es dennoch Grund zur Hoffnung: die Jugend. Viele junge Männer und Frauen im Zentralirak und in der KRI kämpfen entschlossen und gemeinsam für einen sicheren und gerechteren Irak.
9. Meilensteine der Frauenrechtsarbeit

Seit Jahrzenten setzen sich Frauenrechtler:innen im Irak und der KRI für Gleichberechtigung und den Schutz von Frauen und Mädchen ein. In der KRI bewirkten sie die Einrichtung staatlicher Institutionen, die die Umsetzung von Frauenrechten überwachen sollen. Seit 2011 stellt ein Gesetz „häusliche Gewalt“ in der KRI unter Strafe. Im Zentralirak blockiert das Parlament seit 2019 ein solches Gesetz.
Als eines der ersten Länder der Region hat der Irak einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Resolution 1325 aufgestellt. Ein erster Strategieplan gegen geschlechtsbasierte Gewalt wurde Anfang 2022 festgelegt. Doch für die Aktivist:innen wird ihr Einsatz zunehmend gefährlich. Konservative Gruppen greifen Frauenrechtler:innen über die Sozialen Medien, aber auch in der nicht-digitalen Öffentlichkeit an. Die Attacken sind so heftig, dass einige Organisationen ihre Aktivitäten einstellen und Aktivist:innen den Irak verlassen mussten.
(Stand: 06/2023)
Zahlen & Fakten aus der Praxis
Partnerorganisationen:
- EMMA - Organisation for Human Development
- The Lotus Flower
Projektregionen:
- Kurdische Autonomiegebiete
Projektschwerpunkte:
- Lobby-, Aufklärungs- und Präventionsarbeit zum Schutz von Frauen und Mädchen
- Stress- und traumasensible Angebote für Überlebende
- Vernetzung von Aktivist:innen, feministischen Organisationen und Netzwerken
Finanzierung (Mittelgeber):
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH)
- Eigenmittel
Quelle: Jahresbericht 2022
© Dreimalig/medica mondiale
Arbeitsschwerpunkte
Seit 2014 engagiert sich medica mondiale für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, die neben Geflüchteten aus Syrien sehr viele intern Vertriebene aufgenommen hat. 2016 hat medica mondiale ein Büro in Dohuk eröffnet, das die Arbeit vor Ort koordiniert. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen arbeiten wir in folgenden drei Handlungsfeldern:
1. Gewalt gegen Frauen verhindern

Aufklärung und politische Advocacy-Arbeit
Die Frauenrechtsorganisation EMMA verfolgt das Ziel, geschlechtsspezifische Gewalt zu beseitigen und Frauen zu stärken. EMMA sensibilisiert Regierungsinstitutionen für den Umgang mit Gewaltüberlebenden und betreibt intensive Lobby- und Netzwerkarbeit auf politischer Ebene: für Gewaltprävention, den Schutz und die Rechte von Frauen und Mädchen. EMMA sensibilisiert die Öffentlichkeit und das soziale Umfeld von Überlebenden für deren schwierige Situation, ihre Bedürfnisse und Rechte.
Für die Situation jesidischer IS-Überlebender sensibilisieren
Explizit setzt sich EMMA für jesidische Frauen und ihre Kinder ein, die während oder nach ihrer Gefangenschaft beim sogenannten Islamischen Staat (IS) geboren wurden. Auch die Frauenrechtsorganisation The Lotus Flower spricht durch gezielte Sensibilisierungs-, Kampagnen- und Advocacy-Arbeit zu Frauenrechten und sexualisierter Gewalt jesidische IS-Überlebende, ihre Familien sowie relevante gemeindebasierte, öffentliche und politische Akteur:innen an.
2. Überlebende solidarisch unterstützen

Frauen und Mädchen ganzheitlich unterstützen
In Erbil, Dohuk und Shekhan bietet unsere Partnerorganisation EMMA direkte Anlaufstellen für von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen. Psychosoziale Angebote helfen Überlebenden gewaltvolle Erlebnisse zu verarbeiten. Durch Lehrangebote wie Alphabetisierungskurse und Rechtsberatung lernen Frauen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie können sich weiterbilden um später eigenes Einkommen zu generieren und sich so eine Existenzgrundlage aufzubauen. Mit mobiler Beratung in Geflüchtetencamps und aufnehmenden Gemeinden will EMMA auch diejenigen Frauen erreichen, für die der Zugang zu ihren Rechten und Schutz schwierig ist, unter anderem weil es grundsätzlich wenig Angebote für Überlebende gibt und die Versorgung allgemein schwierig ist.
Gewaltbetroffene Frauen und Mädchen empowern

Seit 2021 stärkt medica mondiale mit der Partnerorganisation The Lotus Flower von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen: Box- und Selbstverteidigungskurse stärken Selbstvertrauen, Wohlbefinden, physische und psychische Gesundheit sowie Fitness.
Gesundheitsfachkräfte qualifizieren
Als Teil eines transnationalen Qualifizierungsprogramms schult das Team des Regionalbüros in Dohuk Gesundheitsfachkräfte im traumasensiblen Umgang mit Überlebenden von sexualisierter Gewalt. Zusammen mit lokalen Entscheidungsträger:innen arbeitet medica mondiale daran, dass Stress- und Traumasensibilität zukünftig zum Standard in staatlichen Gesundheitseinrichtungen wird. Überlebende sollen einen besseren Zugang zu stress- und traumasensiblen Gesundheitsdiensten erlangen.
3. Feministische Aktion stärken

medica mondiale arbeitet mit daran, sichere Räume für feministische Reflexion, Verbundenheit, Solidarität sowie Selbst- und Kollektivfürsorge für Aktivist:innen und Frauenorganisationen zu schaffen und zu erhalten. Aktuell gibt es immer wieder Rückschläge für die Frauenrechtsorganisationen. Zum Beispiel greifen konservative Gruppen Frauenrechtsaktivist:innen online wie offline an. Angesichts dieser angespannten Lage und schrumpfender Räume für die Zivilgesellschaft ist es besonders wichtig, Frauenbündnisse und Allianzen in der Region zu stärken.
Nachhaltige Unterstützung: Selbst- und Personalfürsorge
Das von EMMA entwickelte „Staff Care Concept" zur Selbst- und Personalfürsorge leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Aktivist:innen trotz des enormen Drucks, unter dem sie stehen, weiterarbeiten können. Es hilft ihnen dabei, Überlebende sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt langfristig und mit gleichbleibender Kraft unterstützen zu können. Dies ist besonders wichtig, da sich die Teams im Kontext von Stigmatisierung und vielfältiger sozialer, politischer und wirtschaftlicher Krisen bewegen.
Selbstfürsorge für Gesundheitsfachkräfte
Mit einem globalen Qualifizierungsprogramm für Gesundheitsfachkräfte setzt medica mondiale in der Autonomen Region Kurdistan bedarfsorientierte Selbst- und Personalfürsorgemaßnahmen um.
Organisationsentwicklungsprozesse unterstützen
medica mondiale stärkt mit Projekten zur Organisationsentwicklung die Arbeit ihrer Partnerorganisationen im Irak, insbesondere EMMA. Wir unterstützen sie beispielsweise dabei Strategien, Leitlinien und Sicherheitsmanagementsystemen zu entwickeln oder stärken Fach- und Methodenkompetenzen. Ziel ist, die Organisationen in ihrem eigenen, möglichst unabhängigem Handeln zu stärken.
(Stand „Arbeitsschwerpunkte“: 08/2023)
Aktuelles aus dem Irak