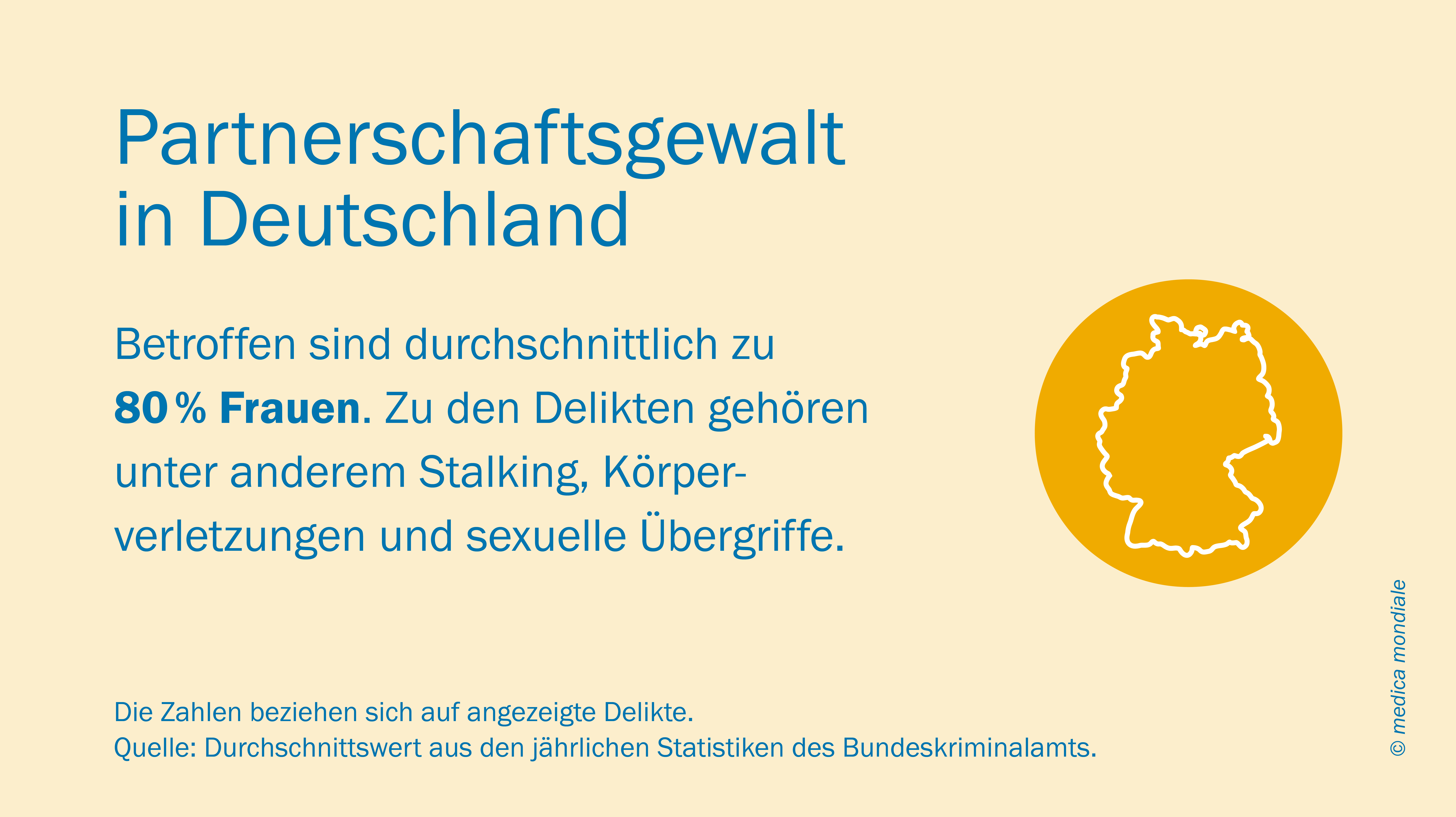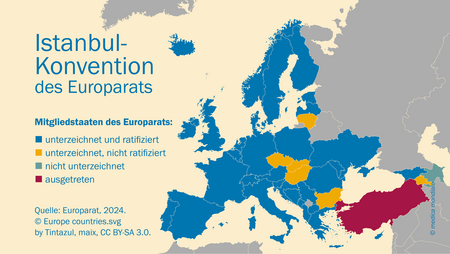Istanbul-Konvention – Übereinkommen gegen Gewalt an Frauen

Mit dem Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, kurz Istanbul-Konvention, hat der Europarat das stärkste frauenpolitische Instrument geschaffen, das es aktuell in Europa gibt. Die Konvention überzeugt zum einen durch die Festlegung eines umfassenden Ansatzes zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Zum anderen benennen die Verfasser:innen geschlechtsspezifische Gewalt als eine Menschenrechtsverletzung. Sie sehen ihre Ursache in ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern. Das, ebenso wie ihre Verbindlichkeit, macht die Konvention zu einem starken Instrument für den Einsatz gegen Gewalt an Frauen.
Zahlen & Fakten zur Istanbul-Konvention
Istanbul-Konvention: Was ist das?
Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtliches Abkommen des Europarats. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – so der vollständige Titel – trat 2014 in Kraft. Es erkennt an, dass Gewalt gegen Frauen eine Menschenrechtsverletzung ist und auf ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern beruht. Gewalt gegen Frauen wird folglich als strukturelles Problem anerkannt. Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten zur umfassenden Bekämpfung und Verhütung von Gewalt.
Warum heißt es Istanbul-Konvention?
Die Istanbul-Konvention wurde im April 2011 vom Europarat verabschiedet. Einen Monat später fand im türkischen Istanbul eine Sitzung des Europarats statt, in der die Konvention zum Unterzeichnen freigegeben wurde. Seitdem trägt sie den Namen Istanbul-Konvention. Nachdem die Konvention von zehn Ländern ratifiziert wurde, trat sie 2014 auf internationaler Ebene in Kraft. Deutschland hatte das Übereinkommen bereits drei Jahre zuvor (2011) unterzeichnet, ratifizierte es allerdings erst 2017. Deshalb trat die Istanbul-Konvention in der Bundesrepublik erst am 1. Februar 2018 in Kraft.
Was versteht man unter Gewalt gegen Frauen?
Die Istanbul-Konvention definiert Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung, die „Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zur Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frau geführt haben“ (Präambel). In der Konvention wird ein umfassender Gewaltbegriff verwendet, der neben physischer und sexualisierter Gewalt unter anderem auch psychische und ökonomische Gewalt anerkennt (Artikel 3, Absatz b).
Was versteht man unter häuslicher Gewalt?
„Häusliche Gewalt“ bezeichnet die Gewalt, die von Familienangehörigen oder (Ex-) Partner:innen ausgeht. Weil nicht der Ort des Geschehens diese Form der Gewalt definiert, sondern die gewaltausübende Person, nutzt medica mondiale bevorzugt Begriffe wie partnerschaftliche Gewalt oder Gewalt im sozialen Nahfeld.
Frauen sind sehr viel öfter von Gewalt im sozialen Nahfeld betroffen, vor allem durch ihre männlichen Partner. 2022 wurden weltweit rund 48.800 Frauen und Mädchen von ihren Intimpartner:innen oder anderen Angehörigen getötet. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jede Stunde mehr als fünf Frauen von jemandem aus der eigenen Familie getötet werden.
Wie viel häusliche Gewalt gibt es in Deutschland?
Im Jahr 2022 waren 157.818 Menschen in Deutschland von Gewalt in der Partnerschaft betroffen. 80 Prozent der Opfer waren weiblich. 76 Prozent der Täter:innen – die meisten von ihnen (Ex-) Partner:innen der Betroffenen – waren männlich. 113 Frauen wurden von (Ex-) Partner:innen getötet. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem/ihrer (ehemaligen) Partner:in getötet. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht jährlich eine kriminalstatistische Auswertung mit den offiziellen Zahlen. Doch diese Zahlen geben lediglich einen Überblick über das sogenannte Hellfeld, also die Gewaltfälle, die der Polizei gemeldet wurden. Expert:innen gehen davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt.
Wer finanziert Frauenhäuser?
Betroffene, die in Frauenhäusern Schutz suchen, zahlen festgelegte Tagessätze. Das bedeutet: Frauen, die keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung haben und auch nicht sozialhilfeberechtigt sind, haben keinen gesicherten Zugang zu Schutzeinrichtungen. Dazu gehören beispielsweise Student:innen oder Frauen im Asylverfahren. Eine bundesweite einheitliche Unterstützung für Frauenhäuser gibt es nicht. Stattdessen unterstützen Bund, Länder oder Kommunen die Einrichtungen. Die Förderungen sind oftmals zeitlich begrenzt. Das führt dazu, dass es derzeit bundesweit nur 6.800 Frauenhausplätze gibt – obwohl es laut Istanbul-Konvention mindestens 21.000 Frauenhausplätze geben sollte.
Mitgliedstaaten: Wer hat die Istanbul-Konvention ratifiziert?
Die Istanbul-Konvention ist ein Abkommen des Europarats, einer internationalen Organisation mit 46 Mitgliedsstaaten – darunter die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Eine Mitgliedschaft in der EU oder im Europarat ist aber keine Voraussetzung zur Teilnahme.
Bis Ende 2023 haben 37 Staaten und die EU die Konvention ratifiziert. Darunter beispielsweise Bosnien, Serbien, Polen und zuletzt auch die Ukraine, das Vereinigte Königreich sowie die Republik Moldau. Die Türkei verließ unter internationalem Protest das Abkommen im März 2021.
Ist die Istanbul-Konvention verbindlich?
Erst wenn ein internationales Abkommen von einem Staat ratifiziert wurde, ist das Abkommen für diesen Staat verbindlich. Ratifiziert werden Abkommen in Deutschland durch die Unterschrift des/der Bundespräsident:in, nachdem Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben. Das geschah im Fall der Istanbul-Konvention am 12. Oktober 2017. Damit hat sich Deutschland dazu verpflichtet, die Konvention auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie auf allen Ebenen in Verwaltung und Justiz durch zielführende Maßnahmen und gesetzliche Vorgaben umzusetzen.
Ein Expert:innenkommittee (GREVIO) überwacht die Umsetzung durch die Vertragsstaaten. Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Ländern, die die Konvention nicht umsetzen, gibt es keine.
Warum gibt es Kritik an der Istanbul-Konvention?
Vor allem rechtsnationale Regierungen und Politiker:innen kritisieren die Konvention. Sie stören sich unter anderem daran, dass die Konvention Gewalt gegen Frauen als strukturelles Problem benennt. Zudem wird kritisiert, dass die Konvention mit dem Begriff Geschlecht nicht nur das biologische Geschlecht meint, sondern anerkennt, dass Geschlecht auch sozial konstruiert wird. Manche Gruppierungen stört an der Istanbul-Konvention, dass sie reproduktive Rechte für Frauen stärkt – beispielsweise das Recht auf Schwangerschaftsabbruch – und klassische Geschlechterrollen ablehnt.
Welche weiteren Konventionen gibt es gegen Gewalt an Frauen?
Neben der Istanbul Konvention gibt es das „Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau“ (CEDAW), auch UN-Frauenrechtskonvention genannt. CEDAW ist ein internationales Übereinkommen der Vereinten Nationen, das bereits seit 1981 in Kraft ist. Es verpflichtet die Staaten, die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen voranzutreiben. Die Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ (2000) stellt den Schutz von Frauen und Mädchen vor sexualisierter Gewalt in Krisen- und Konfliktgebieten in den Fokus und verpflichtet die Mitgliedstaaten, Überlebende und Aktivist:innen aktiv an Friedensprozessen zu beteiligen. Es gibt inzwischen neun Folgeresolutionen.
Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Beispiele unseres Einsatzes zum Schutz von Frauen
Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Damit soll garantiert werden, dass jede Frau einen Schutzanspruch gegenüber dem Staat hat und sie nicht vom Wohlwollen Einzelner abhängig ist. Leider mangelt es in vielen Ländern an einer umfassenden und stimmigen politischen Strategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, auch in Deutschland. Die Folge: Frauenrechts- und Hilfsorganisationen müssen diese staatlichen Aufgaben übernehmen.
1. Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen
Im Bereich Prävention setzen unsere Partnerorganisationen in Südosteuropa mit Lobbyarbeit die jeweiligen Regierungen unter Druck. Sie sollen Maßnahmen ergreifen, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Zu den Mitteln der Lobbyarbeit gehören zum Beispiel Veröffentlichungen, Petitionen und internationale Vernetzungsarbeit. Wir von medica mondiale unterstützen sie dabei. Zudem bilden unsere Kolleg:innen Polizeibeamt:innen, Justizangestellte und Krankenhauspersonal weiter und bekämpfen sexistische Genderstereotype beispielsweise, indem sie Schulmaterial erstellen oder Richtlinien für Werbung und Medien.

In Uganda trägt das Team von MEMPROW (The Mentoring and Empowerment Programme for Young Women) zur Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt bei, etwa indem sie in Schulen Trainings zu Frauenrechten anbieten. Junge Frauen erhalten so Informationen über ihre Rechte und das Team ermutigt sie, selbst aktiv Veränderungen mitzugestalten. Zudem schulen unsere Kolleg:innen Polizist:innen zu den Themen Menschenrechte und Gender. Die Mitarbeiter:innen von MEMPROW vermitteln ihnen Wissen zu einem geschlechtersensiblen, präventiven Arbeitsansatz. Sie schauen gemeinsam, wie sie die Aufnahme von Gewaltfälle traumasensibler gestalten können. So kann geschlechtsspezifische Gewalt adressiert und die Re-Traumatisierung gewaltbetroffener Frauen und Mädchen verhindert werden.
2. Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen

Die Istanbul-Konvention will einen umfassenden Schutz für Betroffene von Gewalt sicherstellen. Dazu gehören etwa Rechtsmittel wie Wegweisungen der Täter:innen aus der Wohnung der Betroffenen, aber auch ausreichende Frauenhaus- und Beratungsplätze. Dasselbe gilt für Betroffene sexualisierter Gewalt. So sollen Zentren eingerichtet werden, die etwa nach einer Vergewaltigung traumasensible medizinische und forensische Unterstützung anbieten.
Eine unserer Partnerorganisationen in Afghanistan berät und schult ehemalige Jurist:innen und Jurastudent:innen. Wegen der Machtübernahme der Taliban Mitte 2021 und den darauf folgenden Einschränkungen für Frauen bietet das Team seine Workshops zu Menschen- und Frauenrechten vor allem online an. Es sind Themen, die offiziell nicht mehr unterrichtet werden, aber die in der aktuellen Lage wichtig sind.
3. Strafverfolgung sexualisierter Gewalt
Die Istanbul-Konvention gibt vor, welche Gewalttaten im nationalen Recht als Straftaten definiert werden müssen. Dazu gehören unter anderem psychologische Gewalt wie Stalking, aber auch Zwangsheirat und weibliche Genitalverstümmelung sowie Straftaten, die im Namen der „Ehre“ begangen werden. Es werden zudem Vorgaben für trauma- und sexismussensible Gerichtsverfahren festgelegt. Ein wichtiger Punkt in der Konvention ist, dass gewaltbetroffene Frauen auch ein Anrecht auf Entschädigungen für das erlebte Unrecht haben.
In Bosnien und Herzegowina, das die Istanbul-Konvention ebenfalls ratifiziert hat, arbeiten wir unter anderem mit dem Center of Women’s Right (CWR) zusammen. CWR bietet Rechtsberatung für gewaltbetroffene Frauen und begleitet kritisch Gerichtsprozesse. Sie beobachten, ob die Prozesse fair und gendersensibel ablaufen.
In Serbien setzt sich unsere Partnerorganisation Humanitarian Law Center dafür ein, dass Frauen, die während des Krieges sexualisierte Gewalt erlebt haben, Entschädigung erhalten.
4. Kohärente Politik in der Umsetzung der Istanbul-Konvention

Die Istanbul-Konvention ist verbindlich für alle Politikebenen und legt fest, dass alle staatlichen Bemühungen, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, aufeinander abgestimmt sein müssen. Für Deutschland bedeutet das, dass die Politik der verschiedenen Bundesministerien sich hinsichtlich der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen nicht widersprechen darf. Kommunen, Länder und Bund sind gleichermaßen verpflichtet, auf die Verwirklichung der Konventionsziele hinzuarbeiten.
medica mondiale ist Teil des zivilgesellschaftlichen Bündnisses Istanbul-Konvention (BIK), das auf Bundesebene Lobbyarbeit für die konsequente Umsetzung der Konvention macht.